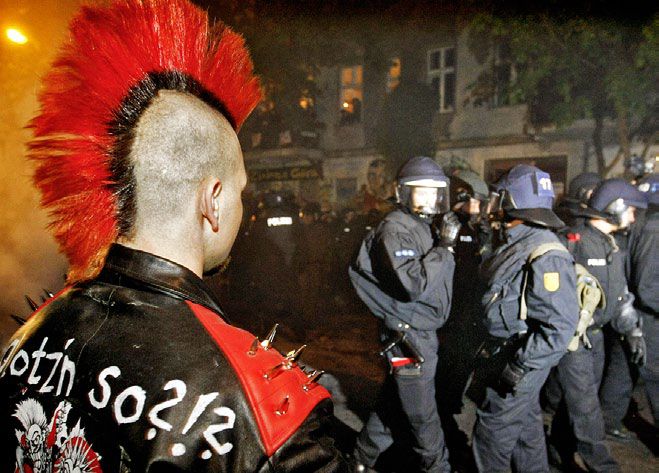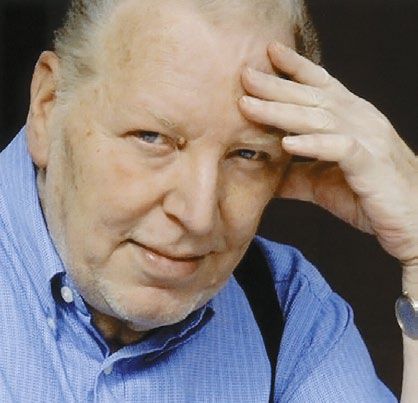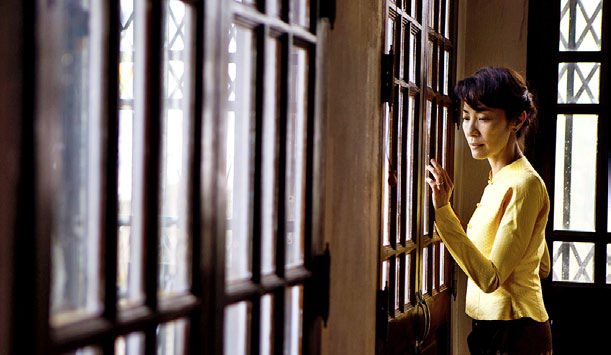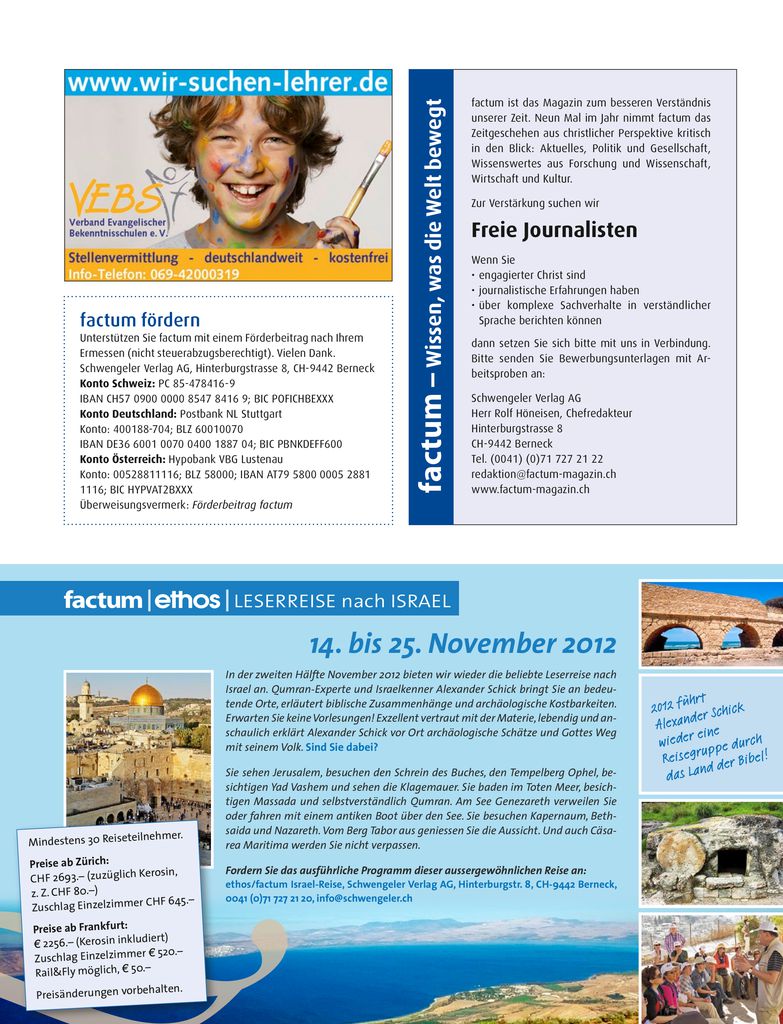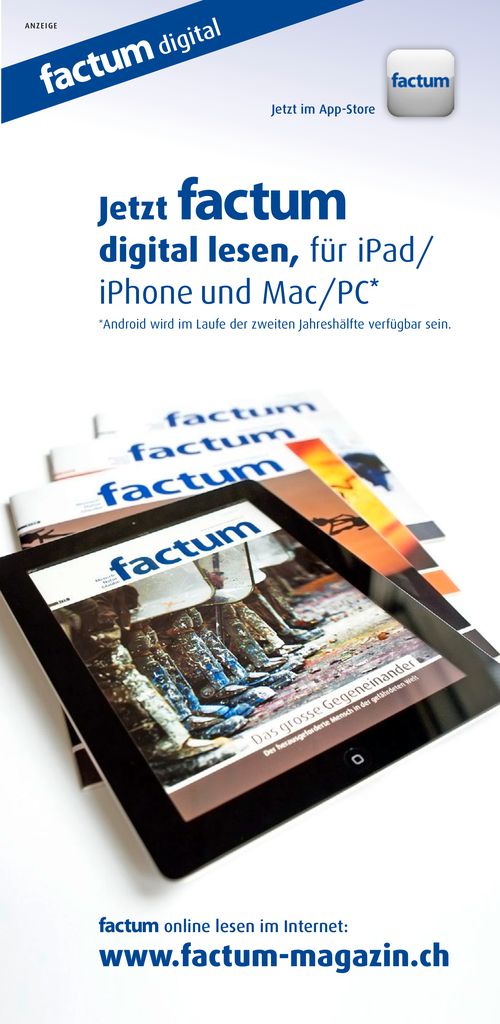Die Wehmut des Atheisten.
Der in London lebende Schweizer Philosoph Alain de Botton ist Atheist. Trotzdem löst bei ihm der Anblick einer Kathedrale jedes Mal einen Schub Wehmut aus. Ihn begeistert diese Architektur. Als Historiker weiss er, dass die Bauleute damals ihre aussergewöhnlichen Ideen und enormen Leistungen dankbar mit Gottes Inspiration und Führung erklärten. Worauf führt ein Atheist seine Arbeit zurück? Wem ist er dankbar? De Botton vermisst im atheistischen Dasein den Austausch mit Gleichgesinnten. Ihm fehlen Verhaltensweisen und Räume, wie sie Menschen haben, die von Gott her denken. In seinem neuen Buch «Religion für Atheisten» regt de Botton an, von Religionen zu lernen und Teile ihrer Kultur in einen atheistischen Kontext zu übernehmen. Regelmässige Treffen, Vorträge, Kunst, Architektur, Moral, Dankbarkeit – das alles soll auf menschlichen Ideen wachsen. Es wäre «perfekt», meint der Denker, wenn Atheisten ihr Gemeinschaftsgefühl ausserhalb einer Religion leben könnten. Nun will Alain de Botton ein Zeichen setzen. Mitten im Londoner Bankenviertel plant er einen schwarzen Turm. Der säkulare Tempel soll «in den Menschen schöne, starke Gefühle auslösen». Angesichts des 46 Meter hohen Bauwerks sollen sich die Besucher «klein, aber nicht gedemütigt fühlen». Im Inneren des Turms sieht er die Darstellung der Evolution des Lebens; die Aussenhülle soll der Gencode des Menschen zieren.
Das Kopieren der Form.
Das Schaffen atheistischer Anbetungsorte ist keine neue Idee. Schon im 19. Jahrhundert versuchte der Franzose Auguste Comte den Humanismus in einen religiösen Mantel zu stecken. Weil er der Pseudowissenschaft der Phrenologie glaubte, tippte er sich jeweils an jene Stelle des Kopfes, wo diese Lehre die Impulse für Fortschritt, Selbstlosigkeit und Ordnung vermutete. Das war sein tägliches Ritual. 1870 wurde in London eine Kirche des Humanismus gegründet. In Paris, Rio, New York und Liverpool entstanden atheistische Tempel. Alain de Botton dreht heute an einem Rad, das sich nie richtig gedreht hat. Die Atheistentempel hielten sich kaum 60 Jahre. Der Atheismus verbreitete sich in anderen Formen. Auf politischem Weg durch den Kommunismus. In den Wohlstandsgesellschaften durch die Mächte des freien Marktes mit ihren Einkaufszentren als «Tempeln». Heute kommen Wissenschaft und Technik immer mehr übergeordnete Macht zu. Sie schüren bereits Träume, die sonst nur im Bereich des Glaubens gedacht werden. Etwa die Hoffnung, dass das menschliche Gehirn per Upload in den virtuellen Raum geschickt werden kann, wo es gegenüber dem Tod immun sein soll. Hier wird gefährlichen Irrtümern geglaubt.
Das Ablehnen des Wortes.
Schon Auguste Comtes humanistische Religion basierte auf Wissenschaft. Deshalb reichten deren Erklärungen nie weiter als die wissenschaftlichen Ergebnisse. Comtes «Kirche» brach zusammen. Die Gedanken, die uns helfen, liegen eben nicht in uns. Das rettende Wort liegt ausserhalb, jenseits unserer Methoden. Dies spürt Alain de Botton, weicht aber der Konsequenz des Glaubens aus, um sich mit Gebäuden, Ritualen und Formen vom Anspruch Gottes abzulenken. Doch das letzte Wort Gottes an die Menschheit (vgl. Hebräer 1,1–5) sucht nach einer persönlichen Antwort.
Rolf Höneisen