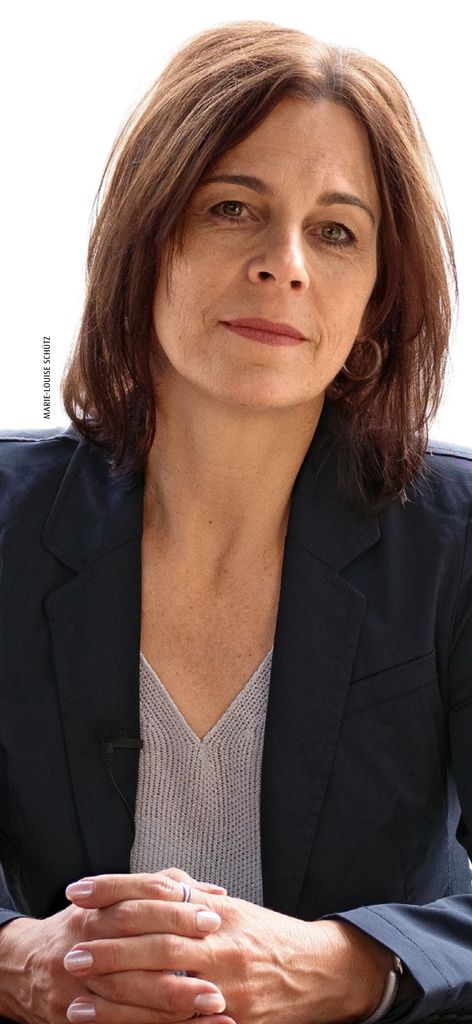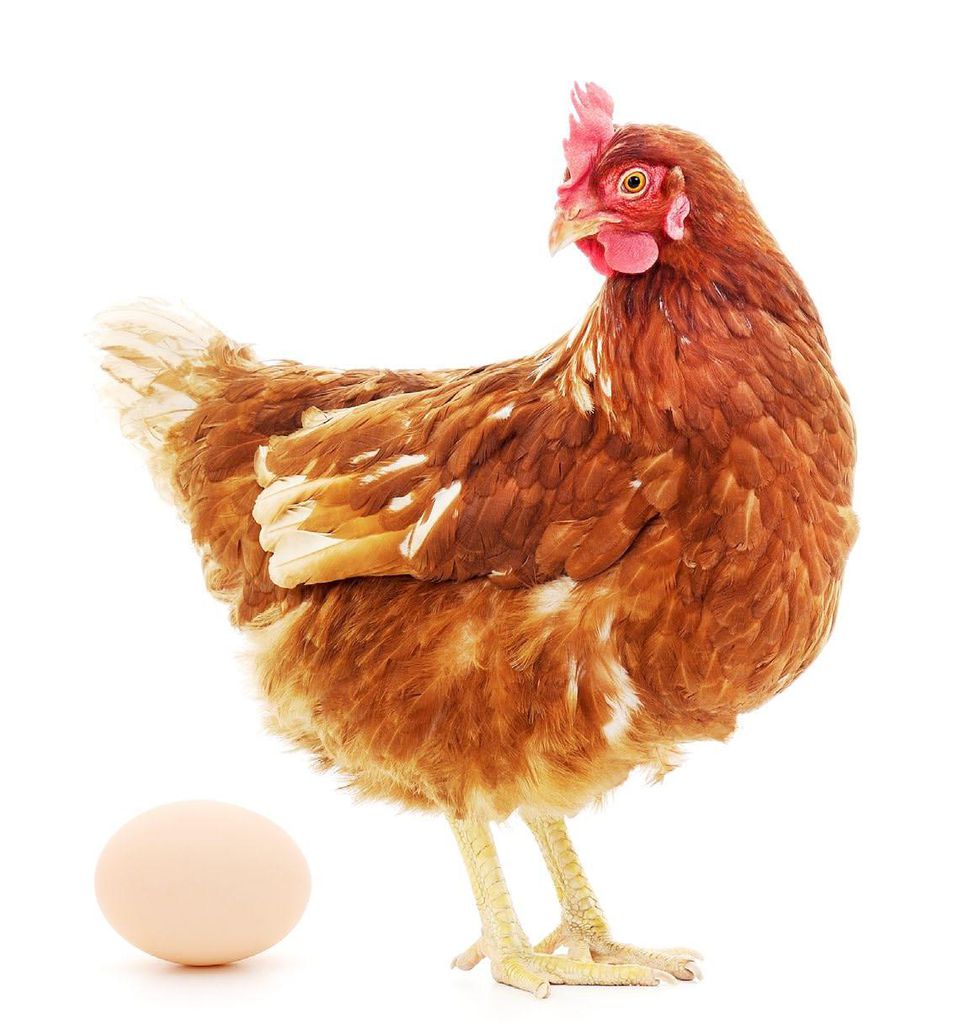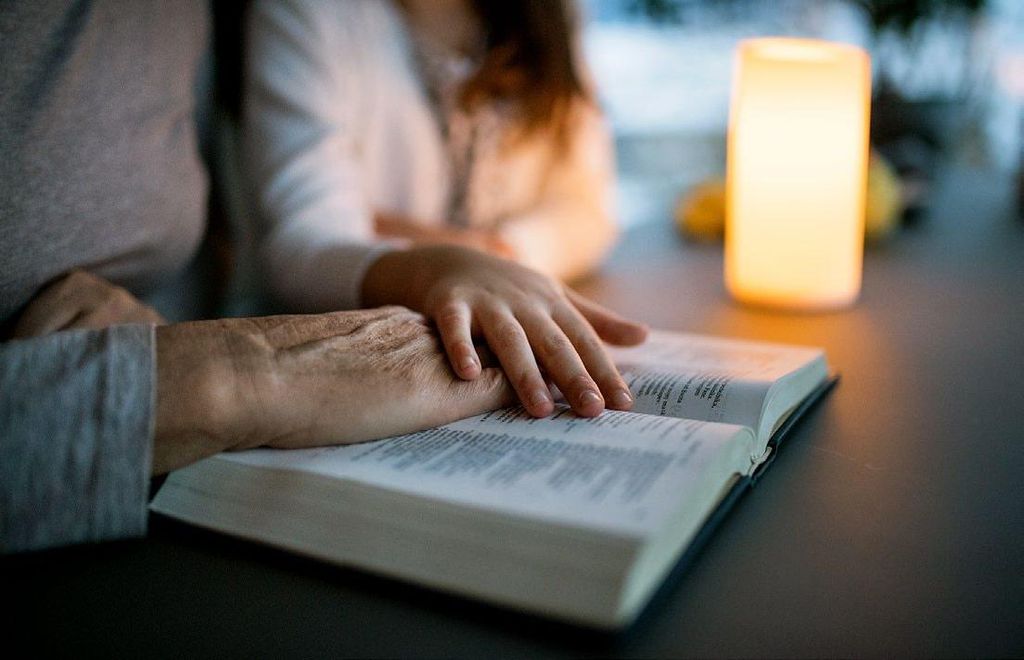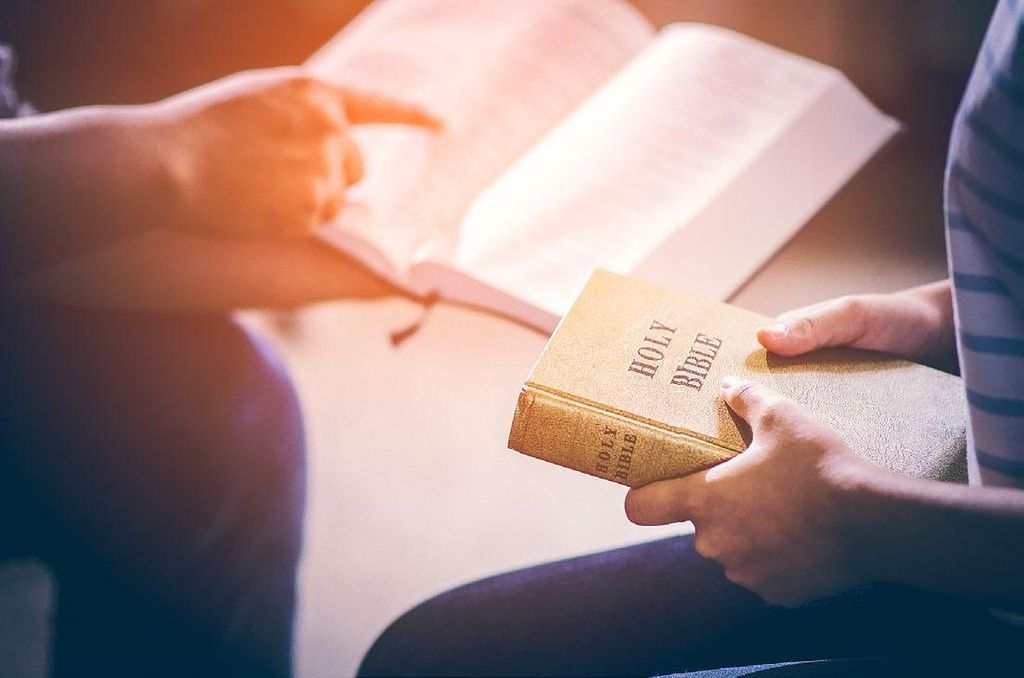LESERBRIEFE
Vorreiter auch in puncto Evolution
zu: «Was hilft und was nicht hilft», 8/18
Vielen Dank für den erfrischenden und zukunftsweisenden Artikel «Was hilft und was nicht hilft».
Israel ist damit wie in manch anderen Bereichen Vorreiter gegenüber dem so «aufgeklärten Westen» eben auch in puncto Evolution, indem es den dahinterstehenden «aggressiven» Naturalismus in die Schranken weist. Es bestätigt damit, was der emeritierte Professor aus Finnland, Matti Leisola, in seinem bemerkenswerten Buch «Evolution – Kritik unerwünscht!» in über 40 Jahren wissenschaftlicher Arbeit zum Besten gab.
In vertraulichen Gesprächen unter vier Augen gaben ihm fast alle ihm bekannten Forscher (und dies sind nicht wenige) zu, «dass die Wissenschaft keine Erklärungen über den Ursprung des genetischen Codes, der Proteine, den Zellmembranen, den Zellen, den Stoffwechselreaktionen und den Grundlagen des Aufbaus der Lebewesen hat». Auch 150 Jahre nach Darwin versagt die Evolutionstheorie beim Versuch, die Komplexität des Lebens zu erklären. Und so lauten zwei seiner herausragenden zehn Thesen:
«Die Revolution der experimentellen Naturwissenschaften beruht auf der Überzeugung, dass das Weltall von einem intelligenten und persönlichen Gott geschaffen wurde.» Und: «Die lebenden Organismen sind komplizierte Systeme, die eine grosse Fülle von Information verarbeiten. Dies kann man am besten durch eine intelligente Verursachung erklären.»
Rainer Urban, DE-Dettingen
Was letztlich zählt
zu: «Wächterinnen der Einfühlsamkeit», 8/18
Sicher gibt es die, doch sicher nicht in dem Masse wie Helfer in der Hospizarbeit generell. Es gibt immer wieder Mitarbeiter, die dies als willkommene Abwechslung zum Alltag sehen. Quasi als «Bonus» bekommen sie Anerkennung zusätzlich zu ihrem Einsatz. In Wirklichkeit aber sind sie unter Leuten und erfahren so manches, was man nicht erfahren hätte, wenn man nicht in der Hospizarbeit wäre.
Als Zweites ist mir wichtig zu sagen, dass in dieser Phase des Lebens, in der Endphase der Sterbephase, es einzig und allein wichtig ist, den Glauben des Sterbenden zu stärken. Es kann aber nur das gestärkt werden, was da ist. Es ist schön, wenn dem Sterbenden etwas vorgelesen wird, was man nicht mehr sagen kann wegen der Schwäche, oder wenn ihm die Hand gehalten wird. Dies kann ein Vorgeschmack dafür sein, wenn einen Jesus an der Hand nimmt. Siegfried Fietz drückt es in einem seiner Lieder sehr schön aus: «Nur eine Hand, nur eine Hand.» Wenn eine Beziehung zu Jesus aufgrund einer ganz bewussten Hingabe an Gott durch Bekehrung nicht stattgefunden hat, kann dies durch eine noch so schöne Gestaltung mit Ritualen, Kerzenschein oder einem beleuchteten Glas nicht ausgeglichen werden. Der, der den letzten Weg geht, muss ihn allein gehen.
Die Tragik ist, dass sich viel zu viele gerade auf die Gestaltung der letzten Stunden verlassen. Ist dies der Fall, ist man verlassen. Dieser Zustand ist eine Aufforderung und geradezu eine Verpflichtung, Menschen mit Jesus bekannt zu machen, damit man sich in der Stunde des Todes des Rufs «Komm, du frommer und getreuer Knecht» freuen kann. Alles andere zählt nicht und hat keinen Bestand.
Mancher mag meine Ausführungen als übertrieben oder zu hart kritisieren. Leider steht es so in der Bibel und diese lügt nicht. Vielmehr ist sie die Wahrheit selber. Wer’s glaubt, wird selig.
Günther und Renate Mayer,
DE-Bernstadt
Fromm eingekleidet
zu: Leserbrief von Christof Kirch «Entspricht nicht den Tatsachen», 8/18
Ein Bekannter von mir, der auch Pastor ist, besuchte besagte MEHR-Konferenz von Johannes Hartl. Als aufmerksamer Zuhörer bestätigte er mir, dass Hartls Botschaften biblisch bis evangelistisch waren. Da gab es vordergründig eigentlich nichts zu beanstanden und er bezeichnete Hartl auch als glänzenden Kommunikator.
Er hat dann aber die Eucharistiefeier besucht, nicht als Teilnehmer, sondern als Beobachter. Protestanten sollten an diesem Abendmahl nicht teilnehmen. Dann allerdings war mein Freund eher schockiert. Es wurde der heilige Ulrich (von Augsburg) mit der üblichen Gebetsformel «Trete für uns ein» angerufen zur Fürbitte und zum Schutz. Maria und einige andere Heilige ebenso. Sein Kommentar: «Typisch katholisch.» Also auch der fromm eingekleidete Spiritismus in Form der Anrufung von Toten, nach katholischer Lehre die Heiligen, wurde praktiziert.
Damit steht im Einklang Hartls tiefe Sehnsucht nach dem eucharistischen Christus. Man wird an 2. Korinther 11,4 erinnert, wenn er schreibt: «Es war bei der eucharistischen Anbetung, einem Phänomen, das für evangelisch-freikirchliche Christen ungemein verwirrend ist, im französischen Wallfahrtsort Paray-le-Monial. Dort lebte im 17. Jahrhundert Margareta Maria Alacoque (1647–1690), eine Ordensschwester, die eindrucksvolle Visionen vom Herzen Jesu hatte. (...) Ich knie am Boden in dieser kalten Kirche und vor mir die Monstranz mit dem Allerheiligsten. (...) Ich war einfach da und mir war, als könne ich direkt und unmittelbar in dieses Herz Jesu schauen. Ich wurde hineingezogen in diesen Vulkan von explosiver Liebe, von der Margareta Maria Alacoque gesprochen hat. Ich konnte eineinhalb Stunden nicht weggehen. Ich war wie paralysiert, wie geblendet, wie hineingezogen in diesen Sog» (Johannes Hartl und Leo Tanner, «Katholisch als Fremdsprache», WeG Verlag, Okt. 2015, S. 91).
Alexander Seibel,
DE-Schöffengrund
Hinweise zu den Leserbriefen
Leserbriefe entsprechen nicht unbedingt der Meinung der Redaktion. Um mehrere Zuschriften veröffentlichen zu können, gelten für Leserbriefe als oberste Länge 40 Zeilen à 60 Anschläge (oder 2000 Anschläge inkl. Leerzeichen). Kürzungen behalten wir uns vor. Sämtliche Zuschriften werden von uns gelesen, auch wenn nicht alle veröffentlicht werden können.
Die FACTUM-Redaktion