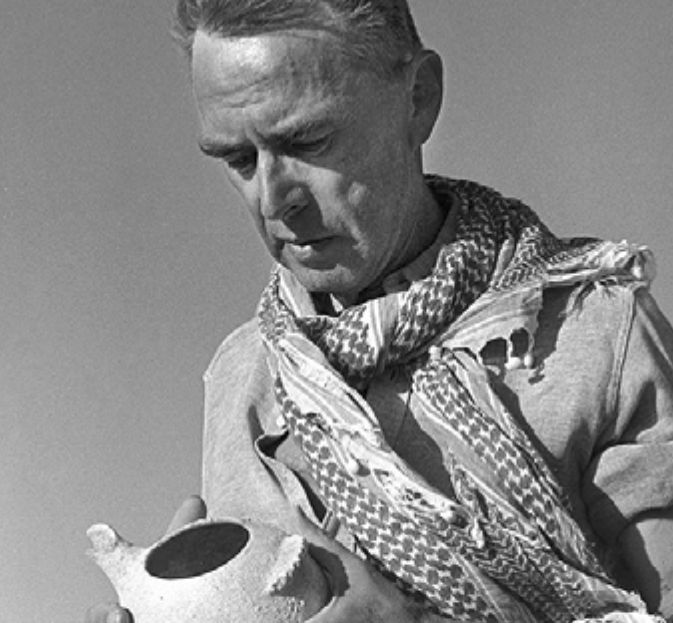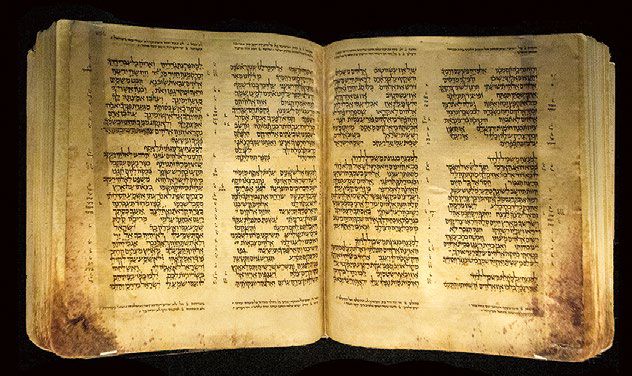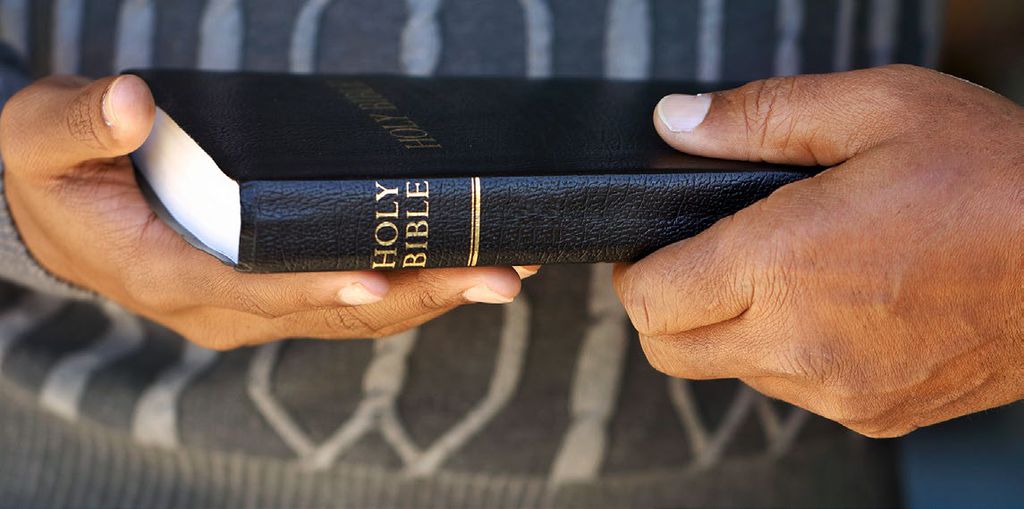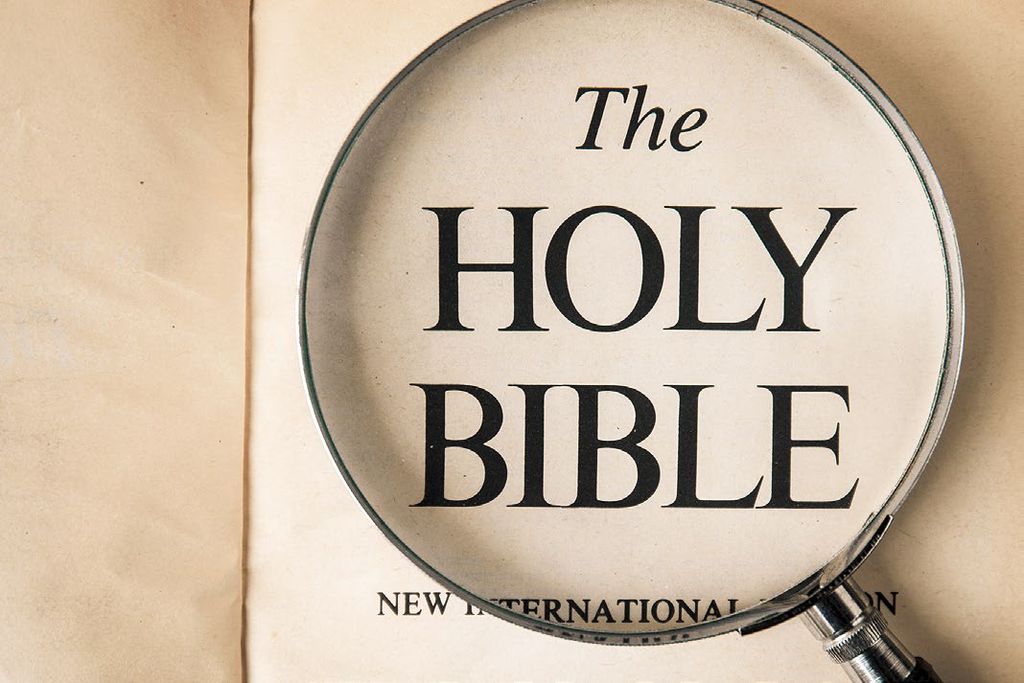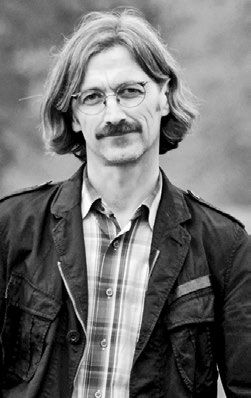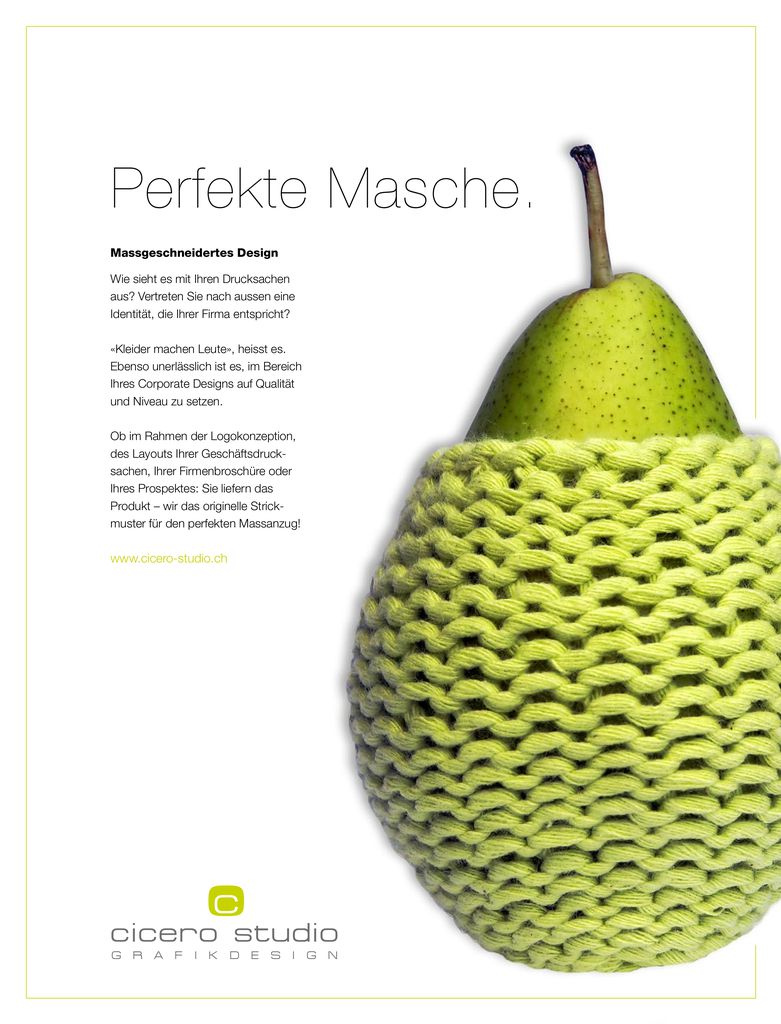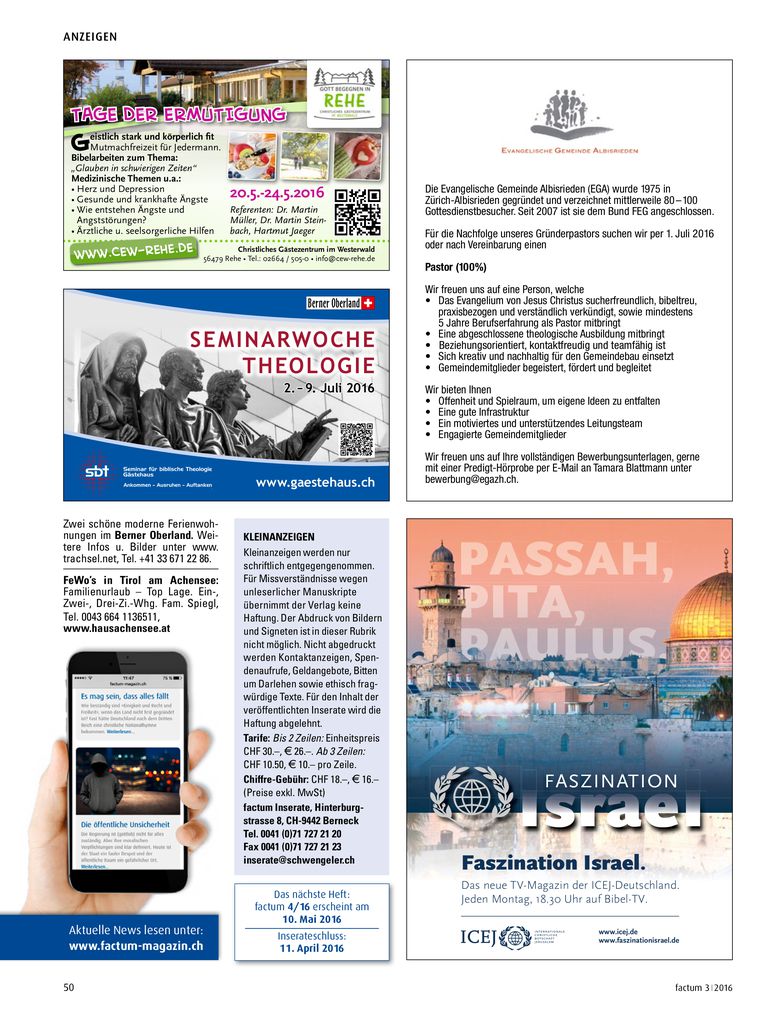Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Vor einem halben Jahrzehnt war in factum von einem der einflussreichsten Intellektuellen der Türkei zu lesen, der in dem Buch «Strategische Tiefe» seinen Traum von einem neuen Osmanischen Grossreich entwickelt hatte, das Nationalstaaten überwindet. Keine islamische Regionalmacht schwebte ihm vor, sondern globale Dominanz: «Unser Spielfeld ist die Welt». Dem «verfallenden Westen könne nur noch die Transformation vom Falschen ins Richtige (zum Islam und zur Scharia) helfen». Damals war dieser Vordenker eines islamischen Imperialismus Aussenminister der Türkei. Heute ist Ahmet Davutoglu Ministerpräsident des inzwischen islamisierten Landes.
Diese Islamisierung war ein weiteres halbes Jahrzehnt zuvor mit dem Machtantritt von Erdogan in der Türkei in factum klar prognostiziert worden. Ich kann mich an kein einziges Medium erinnern, welche diese Einschätzung damals geteilt hätte. Im Gegenteil: Allenthalben war vom kommenden Rechtsstaat, von Demokratie zu lesen. Die Türkei werde ein «Brückenkopf Europas sein, der hineinwirkt in die islamische Welt» und dabei hilft, auch diese zu zivilisieren und zu demokratisieren. In factum stand das Gegenteil: Die Türkei werde zu alles anderem als einem Rechtsstaat, zu einem Brückenkopf des Islam, der hineinwirkt nach Europa. Und so ist es gekommen.
Was mich heute wirklich erschüttert, ist, dass die klar zu erkennende Entwicklung (die in rasendem Tempo vor sich geht) von der europäischen Politik nicht gesehen wird – obwohl die muslimischen Machthaber in Ankara nichts tun, um ihre Absichten zu verschleiern, im Gegenteil (siehe Beiträge S. 8). Mit den sechs Milliarden Euro der Europäer an die Türkei, erst recht mit der kommenden Visafreiheit, haben Erdogan und Davutoglu ihr Ziel erreicht. Das war der «point of no return» für Europa. Erdogan hat jetzt freie Bahn, die Europäer bezahlen ihm noch die Umsetzung seiner Strategie.
Das war dann die Folge davon, dass man die klarste Lektion des 20. Jahrhunderts nicht gelernt hat: Realitätsverleugnung, Beschwichtigungspolitik tötet. Millionen Menschen hätten nicht sterben müssen, wenn der Westen nicht Appeasement gegenüber Hitler mit verantwortlicher Politik verwechselt – sondern sofort entschlossen gehandelt hätte. Heute geschieht dies, in noch grösserem Massstab, gegenüber dem Islam – namentlich der Türkei und dem Iran. Die literarische Beschreibung des Verhaltens von Deutschland und den Europäern lieferte Max Frisch in seinem spannenden Klassiker «Biedermann und die Brandstifter» schon vor Jahrzehnten.
Tausende Muslime kommen unter dramatischen Umständen zum Glauben an Jesus. Sollte uns das nicht von Zukunftsangst befreien, so wie es diese Menschen mutig macht?
Ist das eigentlich Angstmacherei? Der Niedergang der Freiheit könnte einen schrecken, so wie die Reden von Sacharja oder Jesus vordergründig geeignet sind, Ängste zu wecken. Jemand, der noch nicht Gott vertraut, den müssen die Texte der Offenbarung, der Propheten und auch die Drangsalsrede von Jesus in Matthäus 24 in Angst und Schrecken versetzen. Es ist einfach zu ungeheuerlich, was hier angekündigt wird. Die Herausforderung ist, diese Texte so zu lesen, wie dies der Wille von Jesaja und Jesus war – und ist (siehe Beiträge S. 44, 48). Dann machen diese Texte den Weg frei, Gott in unserem Leben handeln zu lassen, ihm zu vertrauen. Tausenden von Muslimen schenkt Gott gegenwärtig unter dramatischen Umständen Befreiung (siehe S. 18, 24, 26). Sollte uns das nicht von Furcht befreien, so wie es diese Menschen mutig macht?
Wo sich Menschen und Nationen von der Wahrheit der Bibel abkehren, geht die Freiheit. Wo sie sich zur Wahrheit der Bibel kehren, da kommen Freude und Dankbarkeit auf. Da hat die Angst keinen Raum mehr. Das ist die Botschaft dieser Ausgabe von factum. Dem Glaubenden werden die biblischen Texte zur erlösenden Lektüre – sie rettet. Wer dies erlebt hat, versteht, weshalb Johannes zum Auftakt seiner Apokalypse schreiben konnte: «Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist! Denn die Zeit ist nahe.»
Ihr Thomas Lachenmaier, Redaktionsleiter